Fertilizing the Void
Sundar Sarukkai
Keynote
Sa., 1.11.2025
19:00
Sylvia Wynter Foyer
Auf Englisch mit deutscher Simultanübersetzung
Eintritt frei
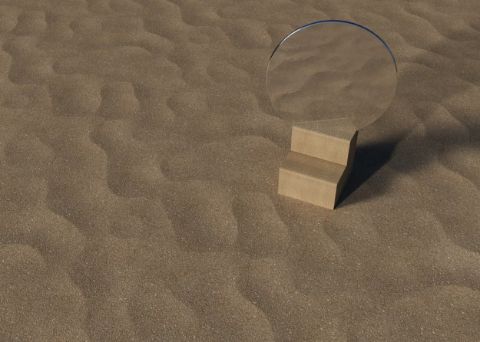
Ein Stapel Blöcke auf einem Teppich (2022). Courtesy Allison Saeng/Unsplash
Das Konzept der Materie ist zum Verständnis der Vorstellungen von Objekten, Körperlichkeit und Konkretheit unerlässlich. Zugleich ist eine Definition des Begriffs der Materie nicht möglich, ohne dabei auf das Nichts – eine Leere, ein Vakuum oder einen leeren Raum – Bezug zu nehmen. Die Quantenphysik hat gezeigt, dass die Atome, aus denen sich „feste“ Materie zusammensetzt, aus dichten Kernen bestehen. Diese Kerne wiederum sind von riesigen Räumen zwischen ihnen und den sie umkreisenden Elektronen umgeben. Es ist daher unmöglich, einen materiellen Gegenstand zu beschreiben, ohne im selben Zug anzuerkennen, dass er größtenteils aus Nichts und nicht aus Materie besteht. Diese scheinbar paradoxe Beziehung zwischen Materie und Nichts ist von zentraler Bedeutung für die Quantentheorie. Sie unterstreicht ihre Beschreibung von Phänomenen wie dem Welle-Teilchen-Dualismus, dem Zustand des Quantenvakuums und seinen Fluktuationen, der Unbestimmtheitsrelation und der Feldtheorie. Über den Bereich der Physik hinaus ist das philosophische Rätsel von Materie und Nichts grundlegend für eine Vielzahl uralter Kosmologien. Das zeigen etwa die jahrhundertelang anhaltenden Debatten zwischen verschiedenen Strömungen des Buddhismus und Taoismus.
Der Mathematiker Georg Cantor (1845–1918) schuf eine Struktur für Zahlen, die mit den Entitäten der Unendlichkeit korrespondierte und diese beschrieb, und demonstrierte damit die Vielfalt des Begriffs „Unendlichkeit“. Auf ähnliche Art können philosophische Überlegungen zum Nichts dazu beitragen, die Leere zu befruchten. In seinem Vortrag Fertilizing the Void (Die Befruchtung der Leere) untersucht der Philosoph und Physiker Sundar Sarukkai die erweiterten Bedeutungen – sowie die Grenzen – des einzigartigen Vokabulars der Quantenwelt und setzt sich mit dessen Beziehung zu philosophischen und künstlerischen Konzepten sowie deren Bezügen innerhalb „alltäglicher” Kontexte auseinander. Laut Sarukkai lenkt das Konzept der Leere die Aufmerksamkeit auf die Unsicherheit des epistemologischen Projekts sowie auf die Grenzen der Ontologie. Er argumentiert, dass die Kunst eine Manifestation dieses großen Aufwallens von Unsicherheit darstellt, die sowohl für die Quantentheorie als auch für die menschliche Existenz grundlegend zu sein scheint. Unsicherheit betrifft nicht nur empirische Phänomene in Bezug auf deren Position und Dynamik. Eine Reduktion der Unsicherheit auf die reine Physik, wie sie die Heisenbergsche Unschärferelation vornimmt, könnte wiederum die Erfahrung des Seins in der Welt verflachen. In diesem Sinne sind physische Objekte, soziale Formationen und letztlich auch die Vorstellung vom subjektiven Selbst bis zu einem gewissen Grad „unsicher”. In seinem Vortrag untersucht Sarukkai diese verschwommenen Grenzen zwischen dem, was etwas ist, und dem, was etwas nicht ist. Er betrachtet sie als Aufforderung, Raum für Unsicherheit zu schaffen.